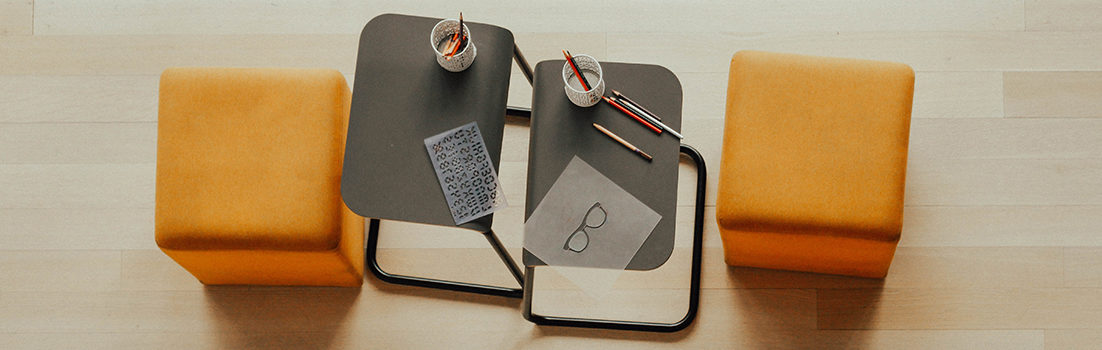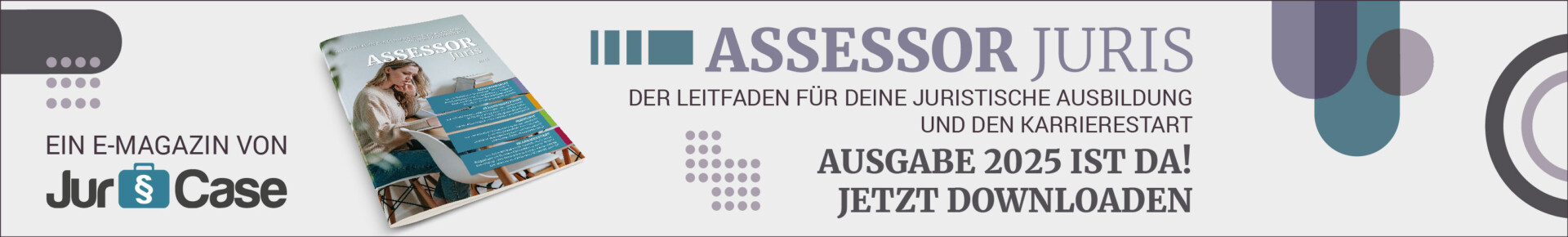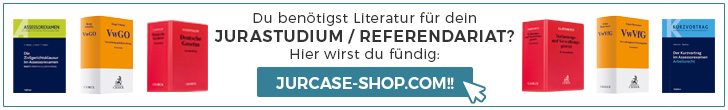Bis zur Entstehung des modernen Eingriffsbegriff wurde der klassische Eingriffsbegriff angewandt. Er hat vier Voraussetzungen:
- der Eingriff muss final sein. D.h. er darf nicht bloß die unbeabsichtigte Folge eines auf andere Ziele gerichteten Staatshandelns sein.
- der Eingriff muss unmittelbar erfolgen und nicht eine bloß beabsichtigte, aber mittelbare Folge des Staatshandels sein.
- der Eingriff muss ein Rechtsakt mit rechtlicher und nicht bloß tatsächlicher Wirkung sein.
- der Eingriff muss mit Befehl und Zwang angeordnet bzw. durchgesetzt werden [E 105,279]
Der klassische Eingriffsbegriff wird inzwischen als zu eng abgelehnt. Die Entwicklung vom klassischen Eingriffsbegriff hin zum modernen Eingriffsbegriff ist ein Resultat der Entwicklung des Rechtsstaates. In immer mehr Lebenslagen ist der Einzelne auf den Staat angewiesen, erfährt hierdurch auch immer öfter existenzgefährdende und freiheitseinschränkende Eingriffe. Desto mehr an Bedeutung die Grundrechte an dieser Teilhabe und Leistung gewinnen, desto mehr Konfliktmöglichkeiten wachsen.
Der moderne Eingriffsbegriff weitet die vier Voraussetzungen des klassischen Eingriffsbegriffs aus. Demnach ist der Eingriff jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechtes fällt, ganz oder teilweise unmöglich macht. Dabei ist es gleichgültig ob diese Wirkung final oder unbeabsichtigt, unmittelbar oder mittelbar, rechtlich oder tatsächlich, mit oder ohne Befehl und Zwang erfolgt. Diese Wirkung muss von einem zurechenbaren Verhalten der öffentlichen Gewalt ausgehen [E 66,39].
Ob der Eingriff auch eine Grundrechtsverletzung darstellt, muss geprüft werden. Denn Eingriffe in Grundrechte können verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.
Grundsätzlich sind Eingriffe rechtfertigungsfähig, soweit sie durch oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen (Gesetzesvorbehalt). Hierbei lassen sich zwei Arten von Gesetzesvorbehalten unterscheiden:
- der einfache Gesetzesvorbehalt ist bei den Grundrechten vorhanden bei denen das Grundgesetz für einen Eingriff lediglich verlangt, dass er durch oder aufgrund eines Gestzes erfolgt. Besondere Anforderungen an das eingreifende Gesetz werden nicht gestellt. Dies ist z.B. bei Art. 8 II GG oder Art. 12 I 2 GG der Fall.
- der qualifizierte Gesetzesvorbehalt stellt an das eingreifende Gesetz weitere Anforderungen. Es muss an bestimmte Situationen anknüpfen, bestimmten Zwecken dienen oder das bestimmte Mittel nutzen. Dies ist z.B. der Fall bei Art. 5 II GG, Art. 11 II GG oder Art. 13 II GG.
Generell muss ein Eingriff materiell und formell verfassungsmäßig sein. Bei der formellen Verhältnismäßigkeit wird geprüft, ob die eingreifenden Organe unter Einhaltung der vorgeschriebenen Formen agiert haben. Hierbei ist insbesondere das Zitiergebot aus Art. 19 I 2 GG ausschlaggebend.
Bei der materiellen Verhältnismäßigkeit sind die – soweit vorhanden – von einem qualifizierten Gesetzesvorbehalt gestellten Anforderungen zu prüfen. Ebenfalls liegt hier die umfassende Prüfung des Verhältnismäßigkeitsprinzips (Art. 20 I GG). Sie erfolgt in fünf Schritten:
Der Eingriff muss einem verfassungsmäßigen Zweck dienen. Bei vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten sind das insbesondere Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechte. Dies sind z.B.
-> Jugendschutz (Art. 6 II GG)
– >Schutz der freiheitlich demokratischen Grundordnung
– >Staatssymbole
Das eingesetzte Mittel muss zur Erreichung des Zweckes geeignet sein. Hierbei muss geprüft werden ob die eingesetzte Maßnahme geeignet ist, den legitimen Zweck zumindest zu fördern. Es muss nicht den Zweck erreichen, sondern es ist ausreichend wenn das eingesetzte Mittel überhaupt zur Zweckerreichung beiträgt.
Das Mittel muss erforderlich sein. Der Gesetzgeber muss das Mittel wählen, was am mildesten ist. D.h. es darf das Grundrechte nicht oder zumindest weniger stark belasten. Steht nur ein Mittel zur Verfügung, ist dieses auch erforderlich.
Der Eingriff muss Angemessen sein. Dieser Prüfungspunkt wird auch die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne genannt. Denn hier muss abgewogen werden ob die Maßnahme die das Grundrecht einschränkt in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Ziel steht. Die Interessen aller Personen müssen berücksichtigt und gewichtet werden. Anschließend muss entschieden werden, wie stark die einzelnen Interessen tatsächlich beeinträchtigt werden. Bei besonders intensiven EIngriffen muss ggf. über eine Abmilderung des Mittels bzw. des Zweckes nachgedacht werden. Dies könnten z.B. Übergangsregelungen, Ausnahmebestände oder Kompensationsregeln sein.
Leichter lässt sich dieser Punkt anhand von zwei Fragen bearbeiten:
1. Welcher Nachteil entsteht dem Grundrechtsträger? Welches seiner Rechtsgüter ist betroffen und handelt es sich um einen schweren oder weniger schweren Eingriff in sein Rechtsgut?
2. Welchen Vorteil will die Verwaltung erreichen?Welche Rechtsgüter sollen durch den Eingriff geschützt oder gefördert werden?