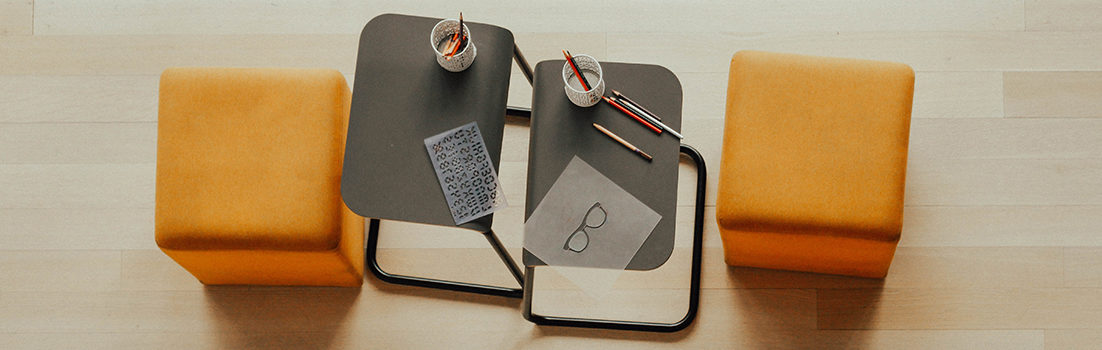Hinter Türchen No. 18 versteckt sich die Amtstracht der Deutschen Justiz. Die Robe.
Während der Verhandlungen haben Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und die Protokollführer Amtstracht zu tragen. Die Ausgestaltung der Roben sind in den Ausführungsverordnungen der jeweiligen Länder geregelt.
Als Beispiel sei hier Brandenburg genannt. Dieses führt in der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Ministers der Justiz und der Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen – Amtstracht bei den Gerichten – aus:
II. Gestaltung der Amtstracht
1. Als Amtstracht ist eine schwarze Robe zu tragen.
2. An der Robe wird ein schwarzer Besatz getragen. Er besteht bei Richtern, Handelsrichtern und den Vertretern der Staatsanwaltschaft aus Samt, Mitgliedern der Berufsgerichtsbarkeiten für Rechtsanwälte und Notare aus Seide und bei Urkundsbeamten aus Wollstoff.
3. Zur Amtstracht sind nach Form und Farbe unauffällige, mit der Amtstracht zu vereinbarende Kleidungsstücke zu tragen.
4. Männer tragen zur Robe ein weißes Hemd mit weißem Lang- oder Querbinder; Frauen tragen eine weiße Bluse, zu der eine weiße Schleife angelegt werden kann. Urkundsbeamte der Geschäftsstelle können auch ein Hemd bzw. eine Bluse von unauffälliger Farbe tragen.
5. Abgeordnete Richter dürfen während des Abordnungszeitraumes ihre bisherige Amtstracht tragen.
Na, da bleiben keine Fragen offen.
Und wem haben wir dieses schöne Stück Stoff zu verdanken? Weiterlesen →